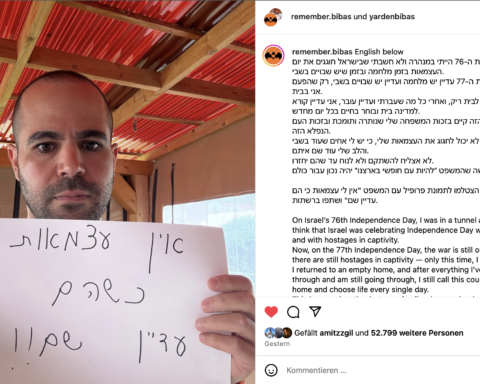Lassen Sie mich ehrlich sein: Wir Schriftsteller und Journalisten haben eine seltsame Faszination für Dramen und Ausnahmesituationen. Denn natürlich schreibt das Leben die besten Geschichten und je aufregender die Zeiten, desto mehr hat man zu schreiben. Wir befinden uns in der vierten Woche des Lockdowns in Israel und meine Stimmung ist überwiegend ganz gut. Obwohl wir, bis auf einen Spaziergang im 100-Meter-Radius um das Haus, quasi nicht mehr raus dürfen. Obwohl das Rausgehen, wenn man es dann wagt, einem Endzeitfilm gleicht (Tel Aviv eine Geisterstadt und die wenigen Menschen die man sieht, tragen fast alle Masken und wechseln die Straßenseite, sobald sie einen entdecken). Obwohl ich im Moment fast gar nicht zum Schreiben komme (mit zwei Kindern, drei und fünf Jahre alt, im Haus ist Ruhe ein Fremdwort geworden), sammle ich innerlich Geschichten, Momente und Gefühle, in der Hoffnung, sie dann irgendwann, wenn das hier vorbei ist, aufs Papier bringen zu können.
Problem ist nur: Wann ist das hier vorbei? Ich finde jeden Zustand, auch den Lockdown, auch die Corona-Krise, die sicherlich in ihrem Ausmaß die größte weltweite Krise seit dem Zweiten Weltkrieg markiert, irgendwie erträglich, wenn ich weiß, dass das alles auch irgendwann wieder zu Ende sein wird. Nur: Wird es das? Und wenn ja, wie wird unser Leben nach Corona aussehen? Wann werden wir wieder auf Konzerten tanzen, unbeschwert reisen und Menschen die Hände reichen können? Im Moment weiß ich nämlich nicht einmal, wann ich meine Eltern und Freunde in Deutschland wiedersehe.
Klar, es ist kein Krieg. Wir müssen einfach nur mal ein bisschen zu Hause bleiben, das wars. Und diese totale Entschleunigung hat sicherlich auch was für sich. Ich lebe in einem sicheren Zuhause, mit drei anderen Menschen, die ich über alles liebe – und wir machen das Beste draus. Aber, und ja, es gibt ein großes aber, ich fühle mich trotzdem an manchen Tagen gelinde gesagt beschissen. Ich fühle mich eingesperrt, meines Lebens beraubt, ich erinnere mich an Nächte mit Freunden in Restaurants und an Reisen, die wir gemeinsam mit unseren Familien erlebten und von denen wir heute noch erzählen, und spüre, wie es im Herzen sticht. Man nimmt das alles so hin, die ganze große Freiheit, hält das für selbstverständlich und dann kommt so ein Virus und fegt einen völlig weg.
In dieser Woche feiern wir Juden Pessach, die Befreiung aus Knechtschaft und Sklaverei, den Sederabend, das große Essen, was eigentlich dazu gehört, werden wir in diesem Jahr in unserer „Kernfamilie“ bestreiten. Während wir normalerweise mit der gesamten Familie zusammenkommen, etwa 20 Leute, dieses Jahr also zu viert. Und die größte Freiheit wird sein, vorher in den Supermarkt zu gehen – der einzige Ort, der weiter als 100 Meter von der Wohnung entfernt sein kann, an den man noch darf. Dass der Shufersal auf der Ben Yehuda Straße mal mein Refugium wird und der Spaziergang dorthin, durch die kleinen engen Tel Aviver Straßen, vorbei an der Botschaft von Sri Lanka und dem Lokal, in dem wir einst Wein tranken, im Schatten der hohen Ficus-Bäume, die große Freiheit bedeuten wird – irgendwie alles surreal. 100 Meter und dann weiter. Auf dem Weg zu einem Supermarkt, der noch nie so große weite Welt schien wie jetzt. Komische Freiheit, diese neue Freiheit.