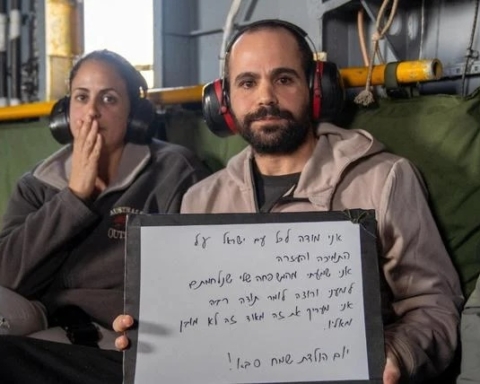Ich bin jetzt ein Skater. Inline Skater um genau zu sein. Jeden Samstag um sieben Uhr morgens packe ich meine Rollerblades ein und fahre in den Park. Das klingt einfach und simpel, aber es war ein langer Weg hierher.
Ich war schon einmal leidenschaftliche Inlineskaterin, als Teenager. Das war Ende der 90er, angeblich die Jahre, in denen mehr als 6 Millionen Inlineskater in Deutschland aktiv waren. Eine von ihnen war ich, von Stralsund nach Parow, vorbei an der BfA, einem der grössten Arbeitgeber bei uns damals, immer auf dem Fahrradweg lang. Mit meiner besten Freundin Anne, ratter ratter über das Pflaster, während wir den wichtigsten Klatsch und Tratsch austauschten. Die BfA wurde mittlerweile eingestampft. Anne und ich sind keine besten Freundinnen mehr, weil ich wegging und sie blieb. Und Inlineskates bin ich seitdem nie wieder gefahren. Lange hatte ich das Gefühl: Hobbys sind für Teenager oder Männer. Die wenigsten Frauen, die ich in Deutschland kenne, haben so richtige Hobbys. Vor allem die Mütter nicht. Man geht vielleicht mal zum Yoga, mal ins Fitnessstudio, aber so richtig regelmässig zwei Mal die Woche, zwei Stunden am Tag, wie mein Mann sich das zum Beispiel leistet – nein, das macht kaum eine.
Väter leben weiter, Frauen kommen zum Stillstand
Es ist ein Phänomen, dass viele Väter ihr Leben beruflich und hobbymässig weiterleben wie vorher, während viele Mütter wie LKWs, die in einen Stau geraten sind, zum Totalstillstand kommen. Liegt es am Stillen? An der Biologie, der Gesellschaft oder einfach daran, dass Männer besser egoistisch sein können als Frauen? Väter in Deutschland z.B. verbringen durchschnittlich 26 Stunden pro Woche mit ihren Kindern, Mütter hingegen 64. Während ich diese Zahlen vom Institut der deutschen Wirtschaft aus dem Mai 2019 lese, frage ich mich, wie die Statistik wohl in Israel aussieht. Wenn ich meinem Gefühl folgen und sagen müsste, wie das bei unseren Kindern in der Kita ist, dann würde ich sagen, dass jeden Tag etwa 30 Prozent der Abholenden Väter sind, 50 Prozent Mütter und 20 Prozent Grosseltern und Babysitter.
Vor allem die Grosseltern spielen ja in Israel eine riesige Rolle und unterstützen ihre Familien wo sie nur können. Meine Schwiegermutter ist auch immer da, wenn wir sie brauchen – obwohl sie nicht gerade um die Ecke wohnt. Aber sie kommt sofort mit ihrer frisch gekochten Kubbeh angereist, wenn ein Kind plötzlich krank wird, wir mal wieder so richtig in Ruhe essen gehen oder für ein Wochenende nach Rom fliegen wollen. Als ich neulich mit meiner eigenen Mutter darüber sprach und zu ihr sagte: „Ich weiss gar nicht, wie ihr das gemacht habt, so ganz ohne die Hilfe eurer Eltern…“ antwortete sie relativ konsterniert: „Wir haben dich halt immer mitgenommen. Ich habe doch kein Kind bekommen, um es wegzugeben.“ Und so dankbar ich meiner Mutter für ihre Aufopferung bin, ich kann das nicht. Ich brauche ab und zu mal eine Pause von meinen Kindern. So wie mein Vater, der immerhin regelmässig zum Wissenschaftleraustausch nach Warna oder Moskau flog, als ich klein war (manchmal für acht Wochen am Stück!), diese Auszeiten wohl auch brauchte.
Nur drei Monate Mutterschutz ändern die Einstellung
Und während ich in den ersten Jahren als Mutter noch grosse Probleme damit hatte, mein Kind „wegzugeben“ (vor allem ohne Schuldgefühl), ging das plötzlich ganz leicht, als das zweite kam. Ich weiss nicht, ob ich einfach erschöpft genug war, oder ob die israelische Art zu leben die deutschen Erwartungen zu dem Zeitpunkt verdrängt hatte. Denn hier ist es so: die meisten israelischen Mütter die ich kenne, fahren regelmässig mit ihren Freundinnen in den Urlaub. Sie haben Hobbys wie Klettern, Surfen oder Yoga auf dem SUP und Samstag vormittag sieht man im Prinzip nur Väter mit ihren Kindern auf den Tel Aviver Boulevards. Ich vermute, die Frauen haben zu dieser Zeit irgendwas anderes zu tun, als Mutti zu sein. Nun werden israelische Mütter vom israelischen Staat aber auch quasi gezwungen, ihre Kinder nach drei Monaten Mutterschutz schon in Fremdbetreuung zu geben und so wieder in ein Leben zurückzukehren, in dem sich nicht immer alles nur um die kleinen Schreihälse dreht. Ganz so schnell ging es bei uns nicht, meine Kinder waren immerhin fünf Monate zu Hause (davon zwei mit ihrem Vater) und dann anfangs nur Halbtags in „Fremdbetreuung“ – aber damit bin ich in Deutschland schon ein ziemlicher Exot.
Ich habe trotzdem einige Jahre Mutterschaft gebraucht, um das Angebot meines Mannes anzunehmen und mir Zeit für mich selbst zu nehmen. Mich von diesen schrägen Erwartungen, diesem Perfektionismus, der mich als Mutter auf einmal gefangen genommen hatte, zu befreien. Jetzt fahre ich regelmässig alleine weg, gehe abends wieder aus und nehme mir einmal die Woche Zeit um Sport zu machen. Auf meiner letzten Berlin-Reise ohne Kinder erinnerte mich eine Freundin daran, wie viel Spass Rollschuhlaufen macht. Ich kaufte mir spontan Inline Skates und nahm mir vor, das in Tel Aviv mal wieder auszuprobieren. Es gibt in Israel nicht viele Inlineskater, zumindest sehe ich ganz selten welche, aber ausgerechnet ein anderer Vater in der Kita meines Kleinsten ist auch Inliner. Er teilte seine beste Route mit mir und ich hatte nun gar keine Ausrede mehr.
Ich glaube ich war noch nie so glücklich, Samstagmorgen um halb sieben aufzustehen, um auf meinen acht Rollen der Zufriedenheit durch den Park zu düsen. Rollend, mit Musik im Ohr denke ich dann eine Stunde lang an gar nichts. Eine Stunde lang denke ich nicht nach vorne und nicht zurück, eine Stunde lang bin ich nur im Moment. Konzentriere mich nur auf den Weg, der direkt vor mir liegt, darauf kleine Abhänge unbeschadet hinunterzukommen und die Übergänge von einem Pflaster zum anderen zu schaffen.
Danach freue ich mich dann umso mehr auf die kleinen Schreihälse.