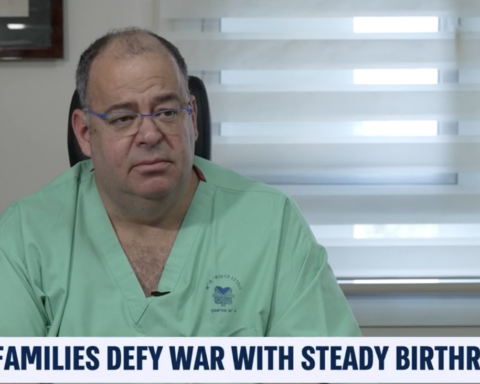Es ist eine Parallelwelt in Tel Avivs Süden: Der Zentrale Busbahnhof der Stadt, ein achtstöckiges Betonmonster, in dem sich vor allem die Gastarbeiter, Immigranten und Flüchtlinge des Stadtteils treffen. Eine Architektursünde, die seltsame Gestalten und Kriminalität nur so anzuziehen scheint. Und doch auch eine Welt voller Überraschungen, mit Galerien, Theatern und einer Fledermaushöhle…
Von Katharina Höftmann
Wir treffen uns im Herzen von Tel Avivs chaotischem Süden. An der Strassenecke Levinsky Yesod Hamaala kann man sein eigenes Wort kaum verstehen. Das liegt vor allem an dem heissblütigen Gemüsehändler, der hinter uns lautstark versucht, seine Süsskartoffeln loszuwerden: „Zwei Kilo für fünf Schekel“, schreit er vorbeilaufende Passanten verständnislos an, so als könne er nicht nachvollziehen, was es bei dem Angebot noch zu überlegen gibt. Doch nicht nur die Lebensmittelpreise in diesem Stadtteil haben nichts mit dem Rest der Stadt zu tun. Vor allem die Bevölkerungsstruktur unterscheidet sich wesentlich vom ansonsten zu 99 Prozent jüdischen Tel Aviv. Hier im Süden leben Gastarbeiter, Immigranten und Flüchtlinge. Das Strassenbild ein ethnisches Mosaik. Afrikaner, Chinesen, Philippinerinnen. Es ist ein einzigartiges Gewusel, in dem wir, eine Gruppe von rund zehn Leuten, uns für die Besichtigung des Zentralen Busbahnhofs zusammengefunden haben. Doch das wahre Chaos liegt noch vor uns. In diesem Block aus Beton, acht Stockwerke, 230.000 Quadratmeter, in den kaum ein Funken Tageslicht gelangt. Gebaut dort, wo früher Orangenplantagen standen. Eine Architektursünde, die in Israel seines Gleichen sucht.

„Der Süden Tel Avivs war nie high society, aber der Busbahnhof, dieses Monster, hat die Gegend endgültig ruiniert“, spricht der Tourguide Architekt Elad aus, was die meisten Israelis denken, „Aber Hass alleine reicht nicht. Denn wenn man den Busbahnhof kennenlernt, muss man ihn irgendwie auch lieben.“ Den Busbahnhof kennen, das tut bisher kaum jemand, der nicht hier im Süden lebt. Leben muss. Die meisten Israelis steigen höchstens auf Etage sieben aus Bussen aus und sehen dann zu, dass sie schnell wegkommen. Das will die Organisation „CTLV“ ändern, die neben der Busbahnhofstour auch weitere Führungen durch den Süden der Stadt anbietet, um den Interessierten „eine andere Perspektive“ zu zeigen, als Kriminalität und Armut, für die der Stadtteil verschrien ist.
Die berechtigte Frage, warum eine vergleichsweise kleine Stadt wie Tel Aviv überhaupt den zweitgrössten Busbahnhof der Welt benötigt, stellt man sich schnell schon gar nicht mehr. Zu überfordert ist man von all den Eindrücken, die in dieser Parallelwelt auf einen einprasseln. Chinatown, Little Philippines und Thai-Land im vierten Stock, wir passieren Afro-Shops zur rechten, traditionelle äthiopische Kleider zur Linken in der dritten Etage und spazieren über eine Schuhstrasse, die zahlreiche Internetcafés von Wechselstuben und Erotikshops trennt. Aus einem der Läden rieselt Kunstschnee, aus einem anderen tönt orientalische Musik. Das Universum Busbahnhof zieht einen sofort in seinen Bann, es macht einen orientierungslos. Süden, Norden, Osten, Westen – man könnte jetzt überall sein auf der Welt, die Stadt von draussen spielt hier, in der „Stadt unter dem Dach“, wie der Busbahnhof einst beworben wurde, keine Rolle mehr. Und wenn nicht ab und zu ein gebürtiger Israeli mit Kippa auftauchen würde, man vergässe überhaupt, in welchem Land man ist.

Architekt Elad führt unsere Gruppe sicher durch das Gewühl von Rampen, nicht funktionierenden Rolltreppen und hin und wieder beissendem Urin-Gestank. Er zeigt Galerien, die man hier nicht vermutet hätte und erzählt uns erstaunten Besuchern, dass es im Busbahnhof allein drei Theater, zwei Synagogen und drei Kirchen gibt. Er lenkt unsere Blicke auch auf die Details, die man leicht übersehen könnte, wie die Tatsache, dass die gesamte Haupthalle im vierten Stock mit sehr kleinen Fliesen (rund 25 x 25 cm) ausgelegt ist, wie man sie sonst aus israelischen Wohnzimmern kennt. In Stockwerk Nummer drei weist er beiläufig auf eine Toilettenkabine hin, in der vor einiger Zeit eine Frau missbraucht und ermordet wurde – auch das ist der Busbahnhof. Es gibt hier viele Ecken, die gruselig anmuten, kaum Sicherheitskameras. Unheimliche Gänge, in denen weit und breit kein Mensch zu sehen ist. Man könnte Horrorfilme hier drehen. Oder den neuen Batman-Streifen: Zwei Ecken von dem Tatort entfernt, liegt eine geschützte Fledermaushöhle in einem Tunnel, über den eigentlich Busse in die Parkgarage fahren sollten.
Rund 50 Prozent der gesamten Busbahnhofsfläche sind nach Auskunft von Elad mit Geschäften belegt – die anderen 50 Prozent sieht man höchstwahrscheinlich nur dann, wenn man in einer Führung unterwegs ist, denn einige Stockwerke wie das zweite sind komplett ungenutzt und verschlossen. Früher haben hier Obdachlose und Junkies gehaust, mittlerweile sorgt ein Sicherheitsdienst dafür, dass sich niemand dauerhaft niederlassen kann. In den stockdusteren Ecken von Etage zwei begegnen uns höchstens ein paar Strassenkatzen. Sie gehören, wie auch die Fledermäuse, zum gut funktionierenden Ökosystem des Busbahnhofs, in dem es keine Insekten und Ratten dafür aber umso mehr Kosten gibt. Über 200 Millionen Schekel Schulden hat die Firma, die den Busbahnhof verwaltet – die Betriebskosten sind weit höher als die Einnahmen. Die Stadtverwaltung wie auch das Land Israel haben nie einen Cent in das Projekt investiert.

Der Neue Zentrale Busbahnhof, wie das Gebäude offiziell heisst, ist ein Projekt, das von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. 1959 lag der erste Bauplan vor, 1993 wurde der Busbahnhof erst eröffnet. Wenn man die langwierige Geschichte von Investoren, Bankrotten, korrigierten Bauplänen und Rettungsversuchen hört, kommt einem dieser Busbahnhof vor allem wie ein Symbol für eine Kette falscher und unglücklicher Entscheidungen vor. So wie es sie überall auf der Welt bei grossen Bauprojekten gibt. Viele Israelis würden das Gebäude am liebsten abgerissen sehen – doch das ist genauso unwahrscheinlich, wie die Hoffnung, dass sich mit dem zentralen Busbahnhof doch noch alles zum Guten wendet.
In der Zwischenzeit macht man, wie so oft in Israel, das Beste draus. Immerhin nicht alles an dem Gebäude ist schlecht: Im Stockwerk Null befindet sich der wahrscheinlich grösste Luftschutzbunker der Welt: Mehr als 16.000 Menschen können sich hier im Falle eines Krieges einfinden. Auf der selben Etage werden auch rund 5 Tonnen Müll pro Woche im eigenen Recycling-Zentrum verwertet. Und im Stockwerk sieben, dort wo Passagiere ein- und aussteigen, scheint plötzlich sogar die Sonne. Von hier oben hat man einen fantastischen Blick über die Stadt bis aufs Mittelmeer. Ausserdem riecht es nach Waffeln, was sich auf Nachfrage, als der Geruch herausstellt, der sich hier oben aus all den Klimaanlagen und Belüftungsschächten der acht Stockwerke zusammenbraut.

Gegen 16.30 Uhr, nach zweieinhalb Stunden, geht unsere Tour zu Ende. Der Schabbateingang naht und Tourguide Elad überlässt uns dem Busbanhof, von dem man wohl nie das Gefühl haben wird, dass man ihn komplett gesehen hat. Das Gesumme und Gewuselt lässt um diese Uhrzeit nach, langsam leert sich das Gebäude, die Händler packen ein und wir müssen minutenlang nach einem Ausgang suchen, der noch geöffnet hat. Und dann spuckt einen das Betonmonster auf der Strasse Tsemach David so plötzlich, wie es einen eingeatmet hat, wieder aus. Nur fünf Minuten später ist man dort, wo man herkam, mitten in Tel Aviv und alle um einen herum sprechen Hebräisch. Es fühlt sich an, als wäre man von einer langen Reise zurückgekehrt.
Weitere Informationen: